AutorIn
Referat: Thomas Hillmann, Zusammenfassung Gabi Niethammer | So erschienen im Alpha1-Journal 2/2022.
Wenn man als Atemtherapeut das gewünschte Ziel bei der Behandlung eines Patienten in einen Satz fassen müsste, dann lautet meines: Bewegung ist die beste Physiotherapie und die beste Atemtherapie, die man machen kann. Schafft man es dann noch, dabei zu lachen, dann ist das die Königsdisziplin der Sekretmobilisation.
Schon bei der Inhalation ist nicht geklärt, wer sie dem Patienten eigentlich beibringen soll. Dies können Ärzte, Physiotherapeuten oder MTAs sein – oder eben niemand, weil sich die eine Berufsgruppe auf die andere verlässt.
Beim Erstkontakt schaue ich mir wertfrei das Atemmuster des Patienten an. Dazu sitzt er auf der Bett- oder Stuhlkante und atmet ganz natürlich. Hier gibt es kein Richtig oder Falsch, da jeder Mensch eine ganz eigene Art zu atmen hat. Wichtig ist für mich zu erkennen, ob die natürliche Atmung möglicherweise Probleme für die Sekretmobilisation machen könnte. Anhand der Körperhaltung und des Atemmusters kann ich häufig bereits sehen, wo es vielleicht eine Sekretproblematik gibt.
Ein Beispiel: Vor mir sitzt jemand, bei dem ich die Atembewegung deutlich nur auf der linken Seite feststelle, wodurch auf der rechten Körperseite viel weniger Ventilation stattfindet und der Schleim festsitzt. Dann ist es meine Aufgabe, die rechte Seite besser belüftet zu bekommen, um eine Überblähung zu vermeiden. Durch gezielte Druckübungen mit meinen Händen unterstütze ich über die sogenannte Kontaktatmung die Ausatmung im Brustkorb und bekomme dadurch wieder mehr Belüftung in die rechte Seite. Somit ist der nächste Atemzug tiefer und das Sekret kann anfangen, sich zu lockern. Ein weiterer wichtiger Hinweis für mich ist, wie der Patient die Lippenbremse anwendet, da sie im Bedarfsfall das Instrument ist, um genügend Luft zu bekommen. Lippenbremse bedeutet nichts anderes, als die Lippen lose aufeinanderzulegen und sie dabei die Luft ausströmen zu lassen. Hier ist nicht der Maßstab, dass viel Druck besser hilft, sondern dass die Luft langsam ausgeatmet wird, damit die Atemwege etwas länger offenbleiben. Drückt der Patient die Luft zu fest aus, dann wird der positive Effekt von außen über die Atemhilfsmuskulatur wieder zerstört.
Eine vertiefte Atmung ist die Bauchatmung, die bei Alphas mit bereits tief stehendem Zwerchfell durch eine vergrößerte Lunge nicht einfach ist. Hier kann es sinnvoll sein, sie wieder zu erlernen.
Eine wichtige Rolle spielt die eigene Hustentechnik. Der Druck, der durch Husten entsteht, geht direkt auf den Beckenboden, und tatsächlich lohnt es sich für Frauen und Männer, ihren Beckenboden zu trainieren, um beim Husten oder Lachen keinen Urin zu verlieren. Eine Hilfe ist hier, eine kleine Drehbewegung während des Hustens zu machen, weil dann die Bauchmuskulatur angesprochen wird und der Druck nicht ungefiltert direkt auf den Beckenboden und die Blase geht.
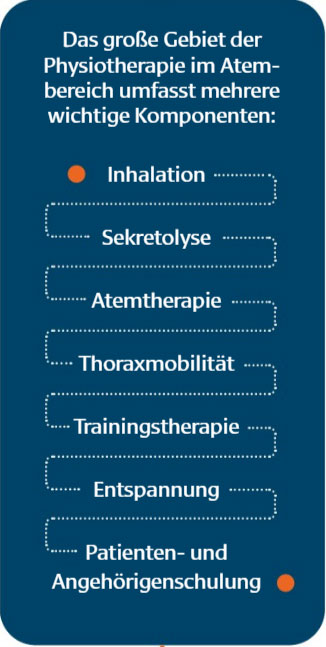
Leider wird in der Atemtherapie viel zu selten mithilfe eines Peak-Flow-Meters der Hustenstoß des Patienten überprüft, obwohl nur mit einer gewissen Hustengeschwindigkeit der Schleim überhaupt nach oben befördert werden kann. Wendet man bei einem bereits schweren Lungenkranken die verschiedenen Schleimlösetechniken an und der Patient kann dann aufgrund seines schwachen Hustenstoßes den Schleim gar nicht nach oben aus der Lunge befördern, wird das Problem eher größer. Deshalb sollte im Bedarfsfall zunächst am Hustenstoß gearbeitet werden.
Ein ineffektiver Husten birgt neben der verminderten Sekretentfernung aus den Atemwegen auch weitere gesundheitliche Gefahren: So steigt u.a. das Infektrisiko und es kommt zu einer Verschlechterung der Sauerstoffsättigung im Blut.
Dringend in der Beurteilung ist der produzierte Schleim – und dies nicht nur für das Fachpersonal, sondern gerade auch für jeden Betroffenen selbst. Deshalb ist es so sinnvoll, sich seinen Schleim regelmäßig anzusehen, denn aus der Konsistenz lässt sich z. B. ablesen, ob es sinnvoll ist, immer weiter mit hochdosiertem Kochsalz zu inhalieren. Ist der Schleim bereits recht flüssig und schaumig, dann ist eine weitere Inhalation nicht angebracht, weil es für den Abtransport des Schleims wichtig ist, eine gewisse Viskosität zu behalten.
Das Hauptziel von Physiotherapie ist, mit der Luft hinter den Schleim zu kommen, um ihn dann mit der Ausatmung nach oben zu transportieren. Ein wichtiges Hilfsmittel ist hier, vor dem Ausatmen die Luft einen Moment anzuhalten. Dies ist eine weitere Technik, die der Patient in der Atemtherapie lernt. Auch hilft in dieser Situation anstelle von isotoner Kochsalzlösung mit 0,9 % eher hypertone Kochsalzlösung mit 3,6 oder 7 %. An die höheren Prozentzahlen sollte man sich beim Inhalieren erst gewöhnen, wobei das größte Problem meist die Inhalationstechnik und nicht das Inhalationsmittel ist. Leider stellen wir immer wieder fest, dass ein Großteil der inhalierenden Patienten ihr Gerät fehlerhaft verwendet und somit nur ein Bruchteil des Medikaments in der Lunge genutzt werden kann.
Man unterscheidet verschiedene Inhalationstechniken:
- Feuchtvernebler (bekannt ist hier vor allem der Pariboy®)
- Dosieraerosole (Notfallspray)
- Pulverinhalatoren
Das Hauptziel ist es, immer so viel wie möglich von dem Inhalat in die Lunge zu bringen.
Beim Feuchtvernebler bleibt zum einen schon ziemlich viel Medikament im Vernebler hängen. Zum anderen muss das Inhalat zwischen Mundraum und Speiseröhre durch eine fast rechtwinklige Kurve gebracht werden. Damit das Medikament nicht im Rachen stecken bleibt, ist es wichtig, den Kopf beim Inhalieren leicht nach hinten zu nehmen, um die Kurve etwas besser zu begradigen. Auf keinen Fall sollte man beim Inhalieren nach unten schauen, auch nicht, um sich während des Inhalierens eine Inhalationstechnik z. B. auf dem Handy anzusehen.
Je schneller der Patient das Inhalat einatmet, umso schlechter kommt das Medikament in der Lunge an. Ziel ist es also immer, so langsam wie irgendwie möglich beim Inhalieren einzuatmen.
Die Königsdisziplin des Inhalierens ist tatsächlich das Dosieraerosol! Ein Beispiel: Ein klassischer Patient in der Klinik mit Rollator kommt zu einer meiner Sportstunden und nutzt bei Ankunft direkt erst einmal sein Notfallspray.

Da er vom Laufen komplett dynamisch überbläht ist (sichtbar an den hochstehenden Schultern), kann nicht viel Medikament in der Lunge ankommen. Eigentlich müsste der Patient erst einmal Luft ablassen, damit das Medikament überhaupt helfen kann. Dann ist es wichtig, das Notfallspray so langsam wie möglich einzuatmen. Das ist schwierig, weil es mit 100 km/h aus dem Dosieraerosol herausschießt und das Ziel sein soll, es mit ca. 20 km/h um die Rachenkurve zu bekommen. Um das zu erreichen, muss der Patient erst einmal zwei, drei Atemzüge ohne Lippenbremse ein- und lange ausatmen. Mit dem Kopf leicht zurück ist dann die Aufgabe, das Inhalat in den Ausatemzug hineinzudrücken und anschließend die Luft anzuhalten, damit der Wirkstoff auch in der Lunge frei werden kann. Tatsächlich ist es so kompliziert, wie es sich anhört, und es ist sehr hilfreich, die richtige Technik mit seinem Atemtherapeuten zu üben.
Bei der Feucht- und Pulverinhalation gibt es ebenfalls Weiteres zu bedenken: Häufig bleibt viel zu viel Medikament an den Zähnen hängen, z. B., weil der Patient die Hände freihaben möchte und deshalb das Inhalationsgerät mit den Zähnen festhält. Ist der Druck der Zähne zu hoch, geht die Zunge automatisch nach oben und das Medikament kommt nicht in der Lunge, sondern unter den Zähnen an.
Heute wissen wir, dass man bei den Pulverinhalaten so zwischen 30 und 100 l benötigt. Das Medikament ist an Laktose gebunden und trennt sich davon. Inhaliert man nun zu heftig, knallt die Laktose in den Rachenraum und das kann zu Stimmveränderungen und verengten Atem wegen führen. Neuere Geräte haben einen Trigger, der die Zugfrequenz steuert, und benötigen nur 30 – 40 l. Aufgrund des eigenen Lufthungers ist es schwierig, langsam zu inhalieren. Deshalb sollte der Patient vom Physiotherapeuten geschult und das wirklich passende Gerät (Device) für ihn ausgesucht werden.
Ein großes Problem ist die dynamische Überblähung. Der Patient atmet immer wieder mehr ein, als er ausatmet. Dadurch gehen die Schultern nach oben und es entsteht der typische Gürtel-Effekt, als hätte einem einer einen Gürtel um den Brustkorb geschnallt. Die Folge ist, dagegen anzuinhalieren und sich noch enger zu fühlen, weshalb der Patient dann davon ausgeht, dass das Medikament nicht hilft. Das Problem ist hier aber nicht das Inhalat, sondern die Überblähung, die erst einmal in den Griff bekommen werden muss.
Für das Sekretmanagement arbeite ich als Therapeut am liebsten mit meinen Händen. Für zu Hause gibt es gute Hilfsmittel, wie die oszillierenden PEP-Systeme, die einem einen positiven Ausatemwiderstand geben und dafür sorgen, dass die Atemwege aufbleiben und die alte Luft ausströmen kann. Manche sind durch Töne verstärkt, die dem Patienten eine noch bessere Kontrollmöglichkeit geben. Das günstigste PEP-System ist die Lippenbremse, gefolgt vom Strohhalm, dem Gehäuse einer kleinen Einwegspritze, bis hin zu Systemen wie dem Pari-PEP® oder BA-Tube®. Grundsätzlich wichtig ist, mit dem geringsten Atemwiderstand zu beginnen und für sich zu prüfen, bei welchem Widerstand die Atemwege möglichst lange aufbleiben.
Zur Sekretmobilisation gibt es weitere Hilfsmittel, die teilweise auch nur in anderen Ländern verwendet werden, wie z. B. eine sehr teure amerikanische Weste, die zwar große Bewegungen in die Lunge bringt, einem jedoch nicht abnimmt, selbst die sekretlösende Atmung anzuwenden. Verschiedene weitere Geräte wie autogene Drainagen, die Active Cycle of Breathing Technique oder der Simeox® Physioassistent runden das Angebot ab. Sie alle haben Vor- und Nachteile, die der Patient mit dem Therapeuten besprechen sollte.
Als Physiotherapeut liegt mein Schwerpunkt darin, den Patienten wirklich anzufassen, zu fühlen, wo das Problem ist, und dann zu behandeln. Notwendig ist es, zu betonen, dass ich nur unterstützend tätig sein kann und die Hauptatemarbeit beim Patienten liegt. Deshalb ist die Bereitschaft, mitzuarbeiten, essenziell.
Kein Hilfsmittel ersetzt die individuelle und aktive Arbeit am und mit dem Patienten!
Sobald sich der Schleim gelöst hat, ist das Entscheidende für den Patienten, in Bewegung zu kommen. Der Teufelskreis: ‚Ich bekomme schlecht Luft und wenn ich schlecht Luft bekomme, mache ich weniger und dann bekomme ich noch weniger Luft und kann wiederum noch weniger machen.‘ muss aufgelöst werden, da sonst die sozialen Kontakte weniger und Vermeidungsstrategien mehr werden. Diese Abwärtsspirale durch Schonung gilt es unbedingt zu durchbrechen. Durch kontrollierte körperliche Aktivität, unabhängig von Schweregrad und Alter, lassen sich positive Effekte auf verschiedene Organe erreichen und die Lebensqualität steigt. Zu beachten ist, dass die Bewegung der Atmung angepasst wird und nicht umgekehrt.
Für alle Nicht-Betroffenen ist es wichtig zu wissen, dass die Atemarbeit eines COPD-Patienten bereits in Ruhe zwölfmal (!) erhöht ist. Hinzu kommt, dass das Fingerpulsoximeter mit seiner Sättigungsmessung keinen Aufschluss darüber gibt, wie gut der Betroffene Luft bekommt. So kann es sein, dass ein Patient mit einer Sättigung von 75 einen Gehtest von 380 m hinlegt, während ein anderer mit einer Sättigung von 98 nur knappe 100 m schafft.
Um die Einschränkung als Angehöriger in Ansätzen nachvollziehen zu können, kann sich der Lungengesunde einmal hinsetzen und durch einen Strohhalm atmen. Fängt er dann noch an, Übungen zu machen, wird er wahrscheinlich nach 40 Sekunden nicht mehr können, weil der Lufthunger so groß ist.
Die Arbeit mit dem Physiotherapeuten dient auch zur Vermittlung von ökonomischen Techniken:
- Abbau von Angst
- Energieeinsparung
- Aufbau von Muskulatur
- Selbstständigkeit / Selbstwertgefühl
- Existenzerhalt (z. B. bei Alleinstehenden)
In der Klinik erlebe ich immer wieder, dass Patienten bei Belastungstests davon ausgehen, dass die Stufen ihrer mobilen Sauerstoffgeräte der Literanzahl entsprechen. Ein mobiler Konzentrator ist auf Stufe 5 nicht gleichzusetzen mit 5 Litern. Unter Belastung bekommen wir eine schnellere Atmung und dann wird das Gerät dauerhaft angetriggert. Ist man aber schon wieder in der Ausatmung, ist man in dem Moment nicht mehr gut versorgt und ein Demandsystem unter Belastung vielleicht nicht das Richtige. Es gilt also im Einzelfall immer zu prüfen, ob ggf. mit einem Dauerflow-System besser trainiert werden könnte.
Bei der Wahl eines Rollators sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass dieser zum Körperbau passt, damit der Betroffene in aufrechter Haltung daran stehen kann, um besser Luft zu bekommen. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten und jemanden anzuleiten, denn die Körperhaltung kann die Vitalkapazität zu 30 Prozent beeinflussen.
Trainieren sollte man Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit sowie Koordination. Dabei gilt es für mich als Therapeuten zu beachten, dass ich den Patienten mit einem individuellen Trainingsplan niedrigschwellig abhole und ihm das Gefühl gebe, das Pensum gut bewältigen zu können. Wichtig ist am Anfang vor allem, dass der Betroffene in Bewegung kommt und durch kleine Erfolge am Ball bleibt. Wir setzen dabei gern auf Intervalltraining zwischen 30 und 60 Sekunden mit anschließender Pause von 30 Sekunden. Dadurch hat die Lunge Zeit, sich wieder zu entblähen, ehe es in das nächste Belastungsintervall geht. Zum individuellen Trainingsplan gehört auch, ausführlich abzufragen, in welchen Lebensumständen sich der Patient befindet, ob er zu Hause z. B. Treppen zu gehen hat, ob er gern Fahrrad fährt, ob er häufiger schwere Einkaufstüten tragen muss usw.
Um einen Trainingseffekt auszulösen, sollte zwei- bis dreimal in der Woche trainiert werden, wobei Erholungszeiten einzuhalten sind. Häufigeres Training führt nur zu wenig oder keiner Leistungssteigerung, eher steigt die Verletzungsgefahr bei sinkender Leistungsbereitschaft. Zum Erhalt der Leistungsfähigkeit sollte eine Einheit pro Woche bei gleichbleibender Intensität durchgeführt werden.
Bewegung mit Bedacht: Wann Atemphysiotherapie pausieren sollte
1. Blutdruck > 220/120 mmHg (RRsyst/RRdiast)
2. Durchblutungsstörung (Ischämiezeichen) oder bedrohliche Rhythmusstörungen im Belastungs-EKG (Elektrokardiogramm
3. Herzkranzgefäßerkrankung mit Beschwerden (Symptomatische KHK)
4. Herzmuskelschwäche mit Flüssigkeitsansammlung im Herzen (Dekompensierte Herzinsuffizienz)
5. Die Durchblutung beeinflussende Rhythmusstörungen des Herzens (Hämodynamisch wirksame Herzrhythmusstörungen)
6. Die Durchblutung beeinflussende Fehlbildung des Herzens (Hämodynamisch bedeutsame Vitien)
7. Unzureichend eingestellter Hochdruck im großen Kreislauf (artielle Hypertonie)
8. Durch einen erhöhten Druck in der Lunge bedingte Überlastung der rechten Herzhälfte, die (körperlich) nicht mehr ausgeglichen werden kann (Dekompensiertes Cor pulmonale)
9. Rechtsherzbelastung bei Hochdruck in der Lunge (pulmonale Hypertonie: PAP > 40 mmHg)
10. Durch Viren und Bakterien bedingte akute Verschlechterung (Exazerbierte COPD / Infekt)
11. Sonstige individuelle Gründe; Abraten des behandelnden Arztes
Das Ziel ist, genau die Fähigkeiten aufzutrainieren, die der Betroffene in seinem Leben benötigt. Und damit er das auch über die Zeit in der Klinik hinaus dauerhaft trainiert, ist es wichtig, dass die Bewegung Spaß macht. Heute gibt es viele gute Sport-Apps mit interessanten Trainingsansätzen (z. B. das Sportprogramm PROMISE von Dr. Inga Jarosch und Dr. Tessa Schneeberger und Sportarten, die auf einer Wii oder mit Virtual Reality gespielt werden können. Wir erleben häufiger im Klinikalltag, dass Patienten bei einem Puls von 120 auf dem Fahrradergometer ihr Anstrengungsgefühl mit einer 8 beschreiben. Tragen sie aber bei gleichem Puls eine Virtual-Reality-Brille, reduziert sich das Gefühl der Anstrengung auf die Hälfte, eben weil sie abgelenkt sind. Neben allem Training darf die anschließende Entspannung nicht außer Acht gelassen werden, da sie für Körper und Seele zur Erholung essenziell ist. Ob sich der Betroffene nun eine der verschiedenen Entspannungstechniken aussucht oder z. B. beim Musikhören regeneriert, ist dabei unerheblich und individuell. Wichtig ist, sich regelmäßig diese Zeit zu nehmen.
Mein Ziel ist, dass der Patient und ich so gut zusammenarbeiten, dass er mich eines Tages gut trainiert, freundlich zur Seite schubst, da er selbst weiß, wie er sich optimal um sich selbst kümmern kann. Dann habe ich als Physiotherapeut alles richtig gemacht und bin zufrieden.

